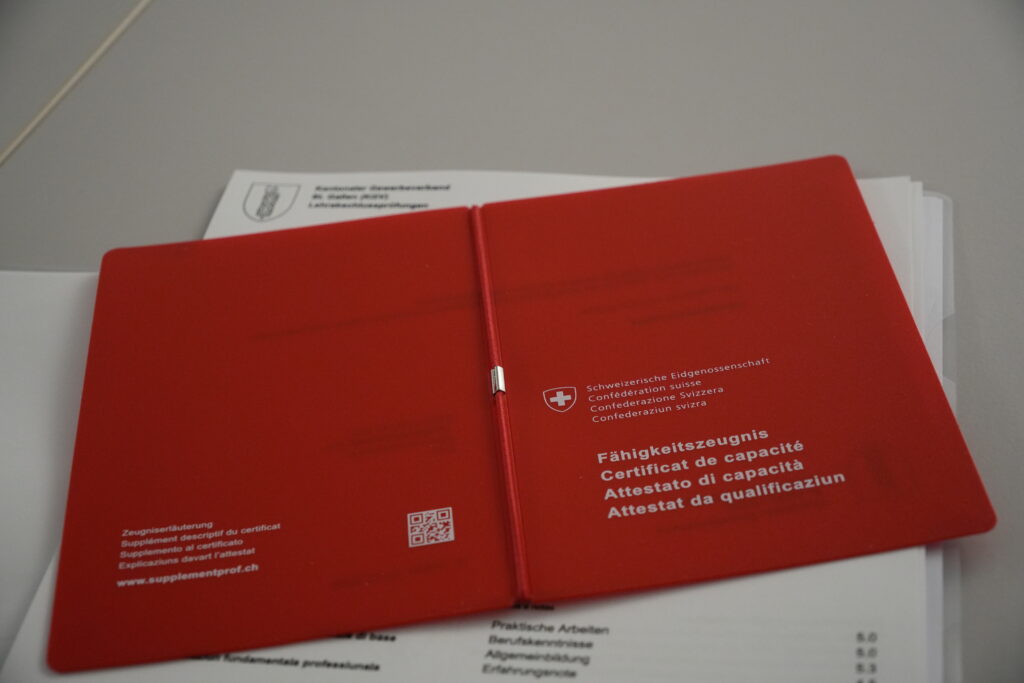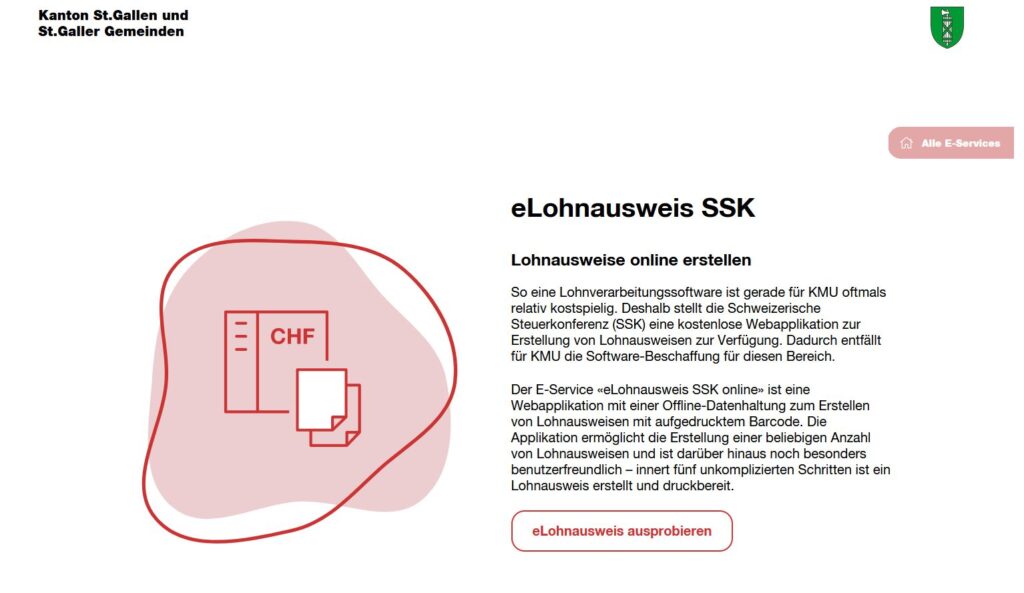Die Redaktion erarbeitet 1-2x jährlich ein Schwerpunktthema, um die Mitglieder des Kantonalen Gewerbeverbandes St.Gallen (KGV) auf besondere Angebote aufmerksam zu machen oder sie zu bestimmten Themen zu informieren bzw. sensibilisieren.
Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen vorherrschend und um die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und unserer Region zu gewährleisten, muss es uns gelingen, diesem Mangel langfristig zu begegnen. Die Personenfreizügigkeit hilft da natürlich mit, jedoch sollte es das Ziel sein, dass wir unsere Berufsleute selbst ausbilden und somit für eine nachhaltige Entspannung am Arbeitsmarkt sorgen. Hier ist es nicht nur entscheidend, dass wir genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, sondern dass der Übergang von der Schulzeit ins Berufsleben möglichst reibungslos funktioniert. Gemäss einer Publikation des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2023 kam es im Beobachtungsraum vom Lehrstart im Sommer 2018 bis 2022 bei 24% der Lernenden zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung. Fast 80 Prozent der Lernenden, die ihre Lehre abgebrochen hatten, finden innerhalb kurzer Zeit eine Anschlusslösung1. Die Gründe sind sicherlich vielschichtig und trotzdem: eine gute Abstimmung der gegenseitigen Erwartungen und Anforderungen von Seiten der Schule und dem Gewerbe an die zukünftigen Lernenden kann zu einem gelungenen Start ins Berufsleben beitragen. Davon profitieren einerseits die Lernenden durch einen optimalen Übergang und der Möglichkeit, ihr berufliches Fundament zu giessen. Andererseits profitieren die Wirtschaft und die Gesellschaft, weil die Aussichten auf einen erfolgreichen Lehrabschluss verbessert und Aufwände im Zusammenhang mit Lehrabbrüchen vermieden werden – eine win-win-Situation. Ein gutes Beispiel, wie man die Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf den Übertritt vorbereiten kann, zeigt der folgende Fall.
Mit dem Mathe-Dossier fit für die Elekroberufe
Der Verband der Elektrobranche Ostschweiz (EIT.ost) hat sich diese Problematik zu Herzen genommen und Massnahmen gegen das Gefälle unter den Lernenden im Bereich der mathematischen Grundkenntnisse ergriffen. Seit bereits vier Jahren ist bei den Elektroberufen das Mathe-Dossier im Einsatz. Ein rund 40 Seiten schweres Heft mit praxisbezogenen Mathematikaufgaben bereitet die 3. Oberstufenschülerinnen und -schüler auf den Lehrstart vor. In der ersten Ausbildungswoche gilt es, das Gelernte beim Einstufungstest unter Beweis zu stellen. Je nach Ergebnis müssen Stützkurse besucht werden. Damit wird sichergestellt, dass alle Lernenden in etwa den gleichen Wissensstand mitbringen und gleichzeitig bleiben die Schülerinnen und Schüler nach der Lehrvertragsunterzeichnung motivierter in der Schule.
Als zusätzliche Massnahme ist EIT.ost kürzlich eine Partnerschaft mit Elektrokompass eingegangen. Die Lernplattform dient der digitalen Förderung von Lernenden. Von Dokumentationstools für Bildungsberichte und Lerndokumentationen über interaktive Aufgabensammlungen bis hin zu niveaugeführten Kursen mit künstlicher Intelligenz begleitete das Tool Lernende durch die Ausbildung. Zudem bietet Elektrokompass einen KI-basierten Schnuppertest als Bewertungshilfe von Schnupperlernenden. Das Ergebnis soll der richtigen Einstufung dienen.
Alle Akteure der Berufsbildung müssen angesprochen werden
Der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen (KGV) ist bestrebt, alle Beteiligten des Übergangs von der Schule ins Berufsleben auf einen Nenner zu bringen. Zu diesem Zweck hat er mitunter ein neues Erklärvideo über das Schweizer Bildungssystem produzieren lassen. Darin werden alle möglichen Wege der schulischen und beruflichen Ausbildung auf einfache Art erklärt. Das Video ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.

Link zum Video: Das Schweizer Bildungssystem
Ausserdem wird in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) eine neue Sonderwoche auf die Beine gestellt. Ziel ist es, dass die Studierenden, welche sehr oft über den rein schulischen Weg an die PHSG gelangen, Einblicke in die berufliche Ausbildung erhalten. Unter anderem besuchen sie während dieser Woche verschiedene Industriebetriebe und lernen die Arbeit der Ausbildungsverantwortlichen kennen. Sie begleiten Lernende aus diversen handwerklichen Branchen in ihrem Alltag und werden über die Rolle und Arbeit der überbetrieblichen Zentren aufgeklärt. Bereits diesen Herbst werden die ersten Studierenden daran teilnehmen können.
Vor kurzem hat sich der KGV-Vorstand zudem für eine Beteiligung an der Plattform Heyjob.ch ausgesprochen. Aufgebaut nach dem Matching-Prinzip soll diese Art der Lehrstellenvermittlung Schülerinnen und Schülern sowie Lehrbetrieben helfen, die passendsten Firmen bzw. Lernenden zu finden. Ab Januar 2026 steht das Angebot den Mitgliedern des KGV kostenlos zur Verfügung. Sowohl Unternehmen als auch Schülerinnen und Schüler füllen dazu einen kurzen Fragebogen aus. Auf dieser Basis schlägt das System passende Matches vor. Betriebe können die Jugendlichen direkt auf ihre Lehrstellen aufmerksam machen. Gleichzeitig haben auch die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, aktiv Kontakt zu den Firmen aufzunehmen. So entsteht ein einfacher, schneller und effizienter Weg zum perfekten Match. Weitere Informationen folgen.
Die Schule formt die Zukunft für den Arbeitsmarkt
Die Schule ihrerseits versucht, die Kinder und Jugendlichen auf ihre späteren Aufgaben in der Berufswelt so gut wie möglich vorzubereiten. Wie die Wirtschaft verändert sich auch der Schulalltag Jahr für Jahr. Immer wieder muss die schulische Bildung überarbeitet und den gesellschaftlichen Veränderungen und technologischen Fortschritten angepasst werden. Mit dem Lehrplan21 ist es erstmals gelungen, eine über alle Kantone einheitliche Bildungsgrundlage zu schaffen. «Die Schülerinnen und Schüler erlangen nebst dem Grundlagenwissen breitflächige Fachkompetenzen, die für eine spätere berufliche Tätigkeit nützlich sind. Angefangen bei den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern über erste praktische Arbeiten mit Holz oder Metall im technischen Gestalten bis hin zu vertieften Office-Anwenderkenntnissen im Medien- und Informatikunterricht», meint Markus Reinhard, Präsident des Verbandes der Oberstufenlehrpersonen im Kanton St.Gallen. Die Redaktion hatte die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch vertiefte Einblicke in die schulische Vorbereitung auf den Berufsalltag zu erlangen.
Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, immer selbständiger zu werden. Für Hausaufgaben und anderweitige Aufträge beispielsweise gilt oft die Holschuld, über die digitalen Plattformen, auf denen die Lehrpersonen Unterlagen und Instruktionen bereitstellen. Ein gutes Absenzenmanagement ist Voraussetzung, dass kein wichtiger Stoff verpasst wird. Zudem wird im Rahmen der selbständigen Projektarbeit eine konzeptionelle und eigenständige Herangehensweise gefordert.
«Die Schule würde es begrüssen, wenn die Referenzen in Bewerbungsdossiers vermehrt eingeholt würden.»
Der ALSV-Fragebogen, kurz für Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten, welcher ein bis zwei Mal jährlich hinsichtlich des Elterngesprächs, zum Einsatz kommt, testet die Selbsteinschätzung der Jugendlichen. Im Gespräch mit den Jugendlichen, den Eltern oder den Erziehungsverantwortlichen werden die verschiedenen Sichtweisen miteinander verglichen und diskutiert. Im Fach Berufliche Orientierung aber auch generell im überfachlichen Kontext werden zudem eine Ich-Findung durchgeführt und an der persönlichen Auftrittskompetenz gearbeitet, um die eigene Wirkung auf die Mitmenschen zu erfahren und für das Vorstellungsgespräch gerüstet zu sein.
Markus Reinhard ist überzeugt, dass eine erfolgreiche Lehrzeit in erster Linie von der Harmonie zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Lernenden abhängt. «Es ist schwierig, wenn Lehrbetriebe nur einen einzelnen Schnuppertag anbieten. Gerade bei Fällen mit konkreten Aussichten auf einen Lehrvertragsabschluss müssten mehrtägige Schnuppereinsätze möglich sein. Nur so merkt man auch, ob die Lehre aus zwischenmenschlicher Sicht gelingen kann.» Er stellt ausserdem fest, dass Lehrbetriebe noch zu selten bei angegebenen Referenzen nachfragen. «Die Schule würde es begrüssen, wenn die Referenzen in Bewerbungsdossiers vermehrt eingeholt würden.», so Reinhard.
Gen Z bringt frischen Wind
Die zwischen 1995 und 2010 geborenen bilden die Generation Z (Gen Z). Sie sind über die letzten Jahre immer mehr im Arbeitsmarkt angekommen. Personen der Gen Z sind komplett mit digitalen Technologien aufgewachsen. Sie gelten als aufgeschlossen, selbstbewusst, freiheitsliebend, umweltbewusst und haben ein Bedürfnis nach freier Entfaltung2.
Im Kurzinterview erklärt Prof. Dr. Alexandra Cloots, Institutsleiterin iDNA – Diversität und Neue Arbeitswelten an der OST – Ostschweizer Fachhochschule, was die Gen Z auszeichnet und welche Vorstellungen sie von einem guten Arbeitgeber haben.
Frau Cloots, wie «tickt» die Gen Z?
Die Gen Z wuchs in Krisenzeiten auf – Klimawandel, Terror, Pandemie – und ist von Social Media geprägt. Das schafft ein
starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit. Im Job bedeutet dies Flexibilität bei Zeit und Ort ebenso wie Teamharmonie. Von «Arbeitsmüdigkeit» kann keine Rede sein. Studien wie die aktuelle Deloitte-Umfrage zeigen vielmehr:
Die Gen Z ist leistungsbereit, strebt nach Wachstum und Lernen, aber ebenso nach Wohlbefinden, Nachhaltigkeit
und sinnvoller Arbeit.
Was für Erwartungen haben Personen der Gen Z an einen Lehrbetrieb bzw. Arbeitgeber?
Sie suchen Sinn, Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit sowie Feedback und Wertschätzung, keine steilen Hierarchien und Karriere um jeden Preis. Unternehmen erwarten Loyalität, Selbstständigkeit und Einsatzbereitschaft, Menschen, die mitdenken und sich anpassen können. Wichtig ist ein Dialog: Betriebe müssen klar sagen, was sie erwarten, und zuhören, was die Jungen wollen. So entstehen Authentizität und die Chance auf einen guten Fit.
Durch welche konkreten Massnahmen zeichnet sich ein guter Lehrbetrieb bzw. Arbeitgeber für die Gen Z aus?
Flexibilität bei den Arbeitszeiten und Homeoffice-Optionen, auch wenn nicht ständig genutzt. Ebenso wichtig sind Nachhaltigkeit, Diversität und Gesundheit im Alltag. Attraktiv sind zudem Teilzeitmodelle, die unterschiedliche Lebensrealitäten berücksichtigen.
Auf welchen Kanälen bewegen sich Personen der Gen Z hauptsächlich? Wo könnten Lehrbetriebe Personen der Gen Z erreichen?
Hauptsächlich auf TikTok, Instagram und LinkedIn, daneben bleiben Firmenwebseiten, Plattformen wie Yousty und die direkte Ansprache in Schulen wichtig. Die Gen Z nutzt auch zunehmend KI bei der Jobsuche. Hier gilt: Authentizität – der Online-Auftritt muss zum realen Betrieb passen.
Und wo kommt das iDNA ins Spiel?
Wir unterstützen KMU beim Verstehen der Erwartungen junger Generationen, beim Entwickeln einer glaubwürdigen Arbeitgebermarke und beim Gestalten einer Arbeitskultur, die zum KMU passt. Denn die Zukunft der Arbeit gelingt nur im Dialog.

Prof. Dr. Alexandra Cloots
Institutsleiterin iDNA – Diversität und Neue Arbeitswelten an der OST – Ostschweizer Fachhochschule
Engagement und Weitsicht gefragt
Die Zeiten, als die Betriebe ihre Lernenden aus zig Bewerbungen aussuchen konnten, sind vorbei. Die Tendenz geht in die Gegenrichtung. Firmen müssen verstärkt auf ihr Lehrstellenangebot aufmerksam machen und über verschiedene Kanäle aktiv Werbung betreiben, damit sie ihre Stellen besetzen können. Deshalb ist es wichtig, stets engagiert zu bleiben und das Unternehmen als guten Arbeitgeber zu präsentieren. Nur so kann dem Fachkräftemangel begegnet und die Ausbildung von qualifiziertem Personal sichergestellt werden. Der KGV hilft, diesen Trend aktiv mitzugestalten.
Quellen: